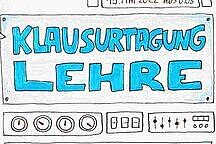Studium und Lehre
Das Referat für Studium und Lehre ist Teil des Fakultäts-Service-Centers und umfasst unter anderem die studentische Studienfachberatung und die Geschäftsstelle der Prüfungsausschüsse der Lehreinheiten Verkehrswesen, Maschinenbau und CES/ITM sowie die Geschäftsstelle der Ausbildungskommission.
Wir sind die zentrale Anlaufstelle für Informationen rund um unsere Studiengänge. Dazu gehören die Organisation von Einführungsveranstaltungen und die Beratung der Studierenden. Zentrale Aufgaben des Referats sind darüber hinaus die Verwaltung, Entwicklung und Akkreditierung unserer Studiengänge, die Evaluation von Studium und Lehre, die Internationalisierung des Studiums, die Kapazitätsberechnung und Öffentlichkeitarbeit.
| Raum | H 8141 |
|---|---|
| Referent*innen für Studium & Lehre | Christine Krejci, André Schelewsky |